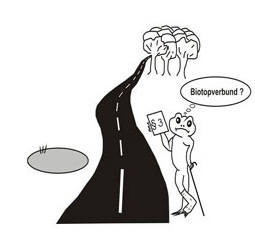Beiträge dieser Seite:
Gefährdungsursachen von Laubfroschvorkommen: standortfremder Fischbesatz |
Rechtliches §§ |
"Aquarienversuche mit Fischen" |
Wohin mit den Fischen ?
Gefährdungsursachen von Laubfroschvorkommen:
standortfremder Fischbesatz
Von Uwe Manzke

Exoten im Netz, gefangen in einem Naturschutzgewässer (Kompensationsmaßnahme) bei Burgdorf.
Fischbesatz in Kleingewässern
ist im Zusammenhang des Laubfroschschutzes (und Amphibienschutzes), einer Gewässser-Verfüllung gleichzusetzen. Zwar
existiert das Gewässer noch, aber in diesem kann, aufgrund der
Fische, keine erfolgreiche Amphibien-Reproduktion (mit Ausnahme von
Erdkröte, Teich- und Seefrosch) mehr stattfinden.
Übrigens können Laubfrösche Gewässer mit Fischbesatz (vor allem Karpfenartige) erkennen, und meiden diese aktiv (vgl. Biologie des Laubfrosches im Jahresgang.
Standortfremder, künstlicher Fischbesatz in den Kleingewässern, besonders mit karpfenartigen (Karausche Carassius carassius, Giebel/Goldfisch C. auratus gibelio, Karpfen Cyprinus carpio, Plötze Rutilus rutilus, Rotfeder Scardinius erythrophtalmus, Moderlieschen Leucaspius delineatus u.a.), ist daher als Totalausfall eines Gewässers zu werten. In Gewässern mit natürlichen Kleinfischbeständen wie Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), sowie bedingt auch 3- und 9stacheliger Stichling (Gasterosteus aculeatus, Pungitius pungitius) können sich Laubfrösche und andere Amphibien zumeist erfolgreich fortpflanzen. Entscheidend ist die Größe, die Struktur und die Vegetation des Gewässers sowie die Fischdichte.

Auch der gefährdete Bitterling darf von Unbefugten nicht ausgesetzt werden!
Oft vermehren sich die in Zoogeschäften und Gartencentern gekauften Fische, vom Goldfisch bis zum Bitterling, in den privaten Gartenteichen sehr gut. In keinem Fall dürfen diese Nachzuchten von z. B. dem Bitterling in die heimische Natur (Kleingewässer, Teiche, Seen, Fließgewässer) ausgesetzt werden, da die Herkunft der Elterntiere unklar ist. Es kann eine Vermischung mit heimischen (autochthonen) Beständen stattfinden und zu einer Gefährdung der verbliebenen heimischen Kleinfische führen. Im Falle des Bitterlings sind exotische, asiatische Stämme im Handel und es existieren bereits Vorkommen mit diesen fremdländischen Bitterlingen. Auch führt das Aussetzen von Fischen in die Kleingewässer (= Fortpflanzungsstätte = Nester = Kinderstube der Amphibien) zu einer unmittelbaren Gefährdung der Lurche (s.o.).
Desweiteren können durch ausgesetzte Tiere und Pflanzen Krankheiten übertragen werden. So starb beispielsweise der Europäische Flußkrebs Astacus astacus seit der Einführung des Kamberkrebses Orconectes limosus und der einhergehenden Verbreitung der Krebspest (eine aus Nordamerika eingeschleppte Pilzkrankheit) seit 1860 fast überall in Norddeutschland und Mitteleuropa aus.

Goldfische gehören nicht in die freie Landschaft!
Seit 2000 ist durch die zunehmende Haltung und Verkauf von Koi-Karpfen nun auch in Deutschland der "Koi-Herpes-Virus" (KHV) nachgewiesen worden. Hierbei handelt es sich um eine bisher unheilbare Krankheit, die ausschließlich Karpfenfische (Cypriniden, vor allem Speise- und Zierkarpfen) befällt. Die meisten erkrankten Fische sterben innerhalb weniger Tage. Einige Tiere überstehen die Ansteckung und werden gegen den Erreger immun. Diese immunisierten Fische sind gefährliche Vektoren ("Carrier") für diese hochansteckende und zumeist tödlich verlaufende Krankheit. Werden daher infizierte Fische in der freien Landschaft ausgesetzt, gefährden diese neben vielen anderen Tiergruppen auch die heimischen Karpfenfische.
Mehr dazu auf den Seiten des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES):
- Zunahme der Koi-Herpesvirus-Nachweise in Niedersachsen
- Presseinformation Nr. 73 vom 20. Dezember 2005 Koi-Herpes-Virus beim Speisekarpfen: Betreuung von Betrieben gewährleistet.
Tiere aus Gartencentern, Zoogeschäften oder auch aus dem Gartenteich gehören nicht in die freie Landschaft!
Rechtliches §§
Von Uwe Manzke
Nach dem Niedersächsischen Naturschutzgesetz (NNatG § 44) und dem Niedersächsischen Fischereigesetz ist es verboten, Fische in der freien Landschaft auszusetzen (oder umzusetzen). Der Besatz mit Fischen ist nur den Fischereiberechtigten gestattet.

Der asiatische Blaubandbärbling gehört nicht in unsere Gewässer!

Graskarpfen - hier ein Jungtier - sind in China beheimatet.
Wer gegen diese Bestimmungen vorsätzlich oder fahrlässig verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit (§ 64 NNatG). Diese kann mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 25.000 € und in besonderen Fällen bis zu 50.000 € geahndet werden (§ 65 NNatG).
Grundsätzlich ist es verboten, standortfremde, nicht einheimische Arten auszusetzen, vgl. "Verordnung über die Fischerei in Binnengewässern (Binnenfischereiordnung), vom 6. Juli 1989". Zu diesen fremdländischen Arten gehören z. B. die verschiedenen Formen des Goldfisches Carassius spec., die Kois Carpio spec., der Blaubandbärbling Pseudorasbora parva, der Graskarpfen Ctenopharingodon idella, der Silberkarpfen Hypophtalmichthys molitrix, der Marmorkarpfen Aristichthys nobilis, der Sonnenbarsch Lepomis gibbosus und auch die verschiedenen Fluss-Krebsarten. Allerdings ist den Fischereiberechtigten in Niedersachsen das Einbringen des nordamerikanischen Kamberkrebses Orconectes limosus in Gewässern ohne Vorkommen des deutschen Flußkrebses / Edelkrebses Astacus astacus erlaubt.
Download: Verordnung über die Fischerei in Binnengewässern (Binnenfischereiordnung), vom 6. Juli 1989.
"Aquarienversuche mit Fischen"
Von Uwe Manzke
Ganz und gar abzulehnen sind scheinbar "wissenschaftliche" Versuche mit Laubfroschkaulquappen (oder anderen Amphibienarten) und potenziellen Prädatoren, wie Fischen, unter Aquarienbedingungen. Zum Einen sind die Ergebnisse nicht auf das Freiland zu übertragen und zum Anderen weiß jeder Aquarianer, dass Futterwahlversuche, oder auch nur das "Untersuchen" (hineinbeißen, kauen, schlucken und ausspucken, etc.) lebender und toter Objekte für Fische im Aquarium alltäglich sind. Dies gilt insbesondere für so aufgeweckte (neugierige) und an Allem interessierte Fische, wie zum Beispiel die beiden einheimischen Stichlingsarten.
In diesem Sinne sind die beiden publizierten Kurzbeiträge "BRANDT, T. (2007): Zwergstichlinge töten Laubfroschkaulquappen unter Gefangenschaftsbedingungen. RANA 8."
sowie "BRANDT, T. (2013): Spitzschlammschnecken (Lymnea stagnalis) und Moderlieschen (Leucaspius delineatus) als Laich- und Kaulquappenprädatoren. RANA 14." anachronistisch (und dienen eher der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse?).
Die im Versuch benutzten und getöteten Amphibien, Laubfrosch und Wasserfrosch, zählen zu den besonders, respektive streng geschützten Tierarten. Dies ist dem Autor auch bewußt gewesen, weshalb er die Herkunft seiner Laubfroschkaulquappen mit "Gefangenschaftszucht" beziehungsweise "aus einer Haltung stammend" angibt. Auch wenn eine genehmigte Haltung und Zucht vorliegen sollte, liegt hier ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und die notwendigen Genehmigungen für derlei "Tierversuche" (bewußte Gefahr der Verletzung, Tötung) von und mit Wirbeltieren vor.
Kurzkommentar:
"Der Vorsitzende im Nichtraucherklub, raucht oft die dickste Zigarre".
Wohin mit den Fischen ?
Die Versuche und Bemühungen, die unnötigerweise mit Fischen besetzten Kleingewässer wieder "fischfrei" zu bekommen, sind oft mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Am geeignetsten erscheint eine Elektro-Befischung. Stellenweise können die Kleingewässer auch leergepumpt und abgefischt werden. Zu beachten ist allerdings bei beiden Maßnahmen, dass sich einige Fische im Schlamm verstecken und überdauern können.
Nach einer Abfischung stellt sich die Frage: "Wohin mit den Fischen?" Bei einer Anfrage an Zoos und Artenschutzzentren habe ich drei mögliche Abnehmer gefunden. Alle drei nehmen gerne das ganze Jahr über lebende (z.T. auch tote) Futterfische für fischfressende Vögel an. Denkbar ist auch die Abnahme der Nachzuchten aus den Gartenteichen, bitte nehmen Sie vor der Abgabe Kontakt mit den genannten Ansprechpartnern auf:
-
Vogelpark Walsrode
Herr Jensen
Tel. 05161 / 60 44 - 12
oder Tel. 05161 / 60 44 - 0 (Frau Wagner)
www.vogelpark-walsrode.de. -
Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen
Florian Brandes
Tel. 05725 / 70 87 - 30
www.wildtierstation.de -
NABU Artenschutzzentrum Leiferde
Bärbel Rogoschik
Tel. 05373 / 66 77
www.nabuzentrum-leiferde.de
Fotoserie: "Beeinträchtigungen"